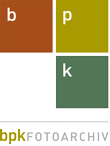Aus den bpk-Beständen: Der fotografische Nachlass von Alfred Kiss
13 Minuten
Aus den bpk-Beständen, Fotografie
Fotografischer Nachlass von Alfred Kiss: Einzigartiges Zeitdokument aus Łódź jetzt online zugänglich.
Zusammenfassung:
Fotografischer Nachlass von Alfred Kiss: Einzigartiges Zeitdokument aus Łódź jetzt online zugänglich
Das Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz hat den fotografischen Nachlass des Łódźer Fotografen Alfred Kiss (1904-1945) grundlegend überarbeitet. Über 1.400 hochauflösende Aufnahmen dokumentieren nun die deutsche Minderheit in Mittelpolen und die NS-Besatzungszeit.
Der spektakuläre Bestand umfasst 4.674 Negative, die Kiss' Witwe 1945 in der Hektik der Flucht aus Litzmannstadt (Łódź) verschickte. Jahrzehntelang blieb das Potenzial dieser Sammlung unerkannt – viele Fotos waren falsch datiert oder verortet.
Durch intensive Recherchen in polnischen und deutschen Archiven sowie zeitgenössischen Zeitungen gelang nun eine präzise Erschließung: Kiss war nicht nur Hobbyfotograf, sondern ab 1940 Leiter der NSDAP-Bildstelle in Litzmannstadt. Seine Aufnahmen dokumentieren NS-Propaganda-Veranstaltungen, Besuche von Größen wie Baldur von Schirach und Robert Ley, die Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung ins Getto sowie die Zerstörung von Synagogen.
Besonders wertvoll: Kiss' Vorkriegsarbeiten für einen völkisch-nationalsozialistischen Fotokreis, die deutschstämmige Bauern und Landschaften als "Zeugen deutschen Kulturwillens" inszenierten. Ein überraschender Fund: Fotografien verschollener Kunstwerke aus dem Łódźer Kunstmuseum.
Alle 1.476 digitalisierten Fotos sind unter www.bpk-bildagentur.de verfügbar – eine einzigartige Quelle zur Stadtgeschichte Łódź und NS-Besatzungspolitik.
News-Beitrag:
(Autor: Jan Böttger)
2022/23 wurde der im bpk verwahrte fotografische Nachlass des deutschstämmigen Łódźer Spinnmeisters, Fotografen und Kaufmanns Alfred Kiss (*10.09.1904 Łódź, +29.03.1945 Kopenhagen) grundlegend überarbeitet und teilweise neu digitalisiert. Der Bestand wurde mit neuen Inventarnummern versehen. Zudem wurden eine Findmittelliste zu den Negativbögen erstellt und Informationen zum Bestand und zur Biographie des Fotografen ermittelt.
In den 1950er Jahren übergab die Witwe des Fotografen einem ihrer Söhne ein Postpaket mit Negativen. Das Paket wurde angeblich 1945 in der Hektik der Flucht gepackt und aus Litzmannstadt, wie die polnische Stadt Łódź 1940-45 von den deutschen Besatzern genannt wurde, an Verwandte im Westen des Deutschen Reiches geschickt. Inhaltliche Informationen gingen dem Sohn nicht zu.
2005 wurde der fotografische Nachlass dem Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz übereignet. Im Bestand befinden sich, der Überlieferung entsprechend, weder Original-Kontaktbögen noch Original-Abzüge noch andere Sammlungsmaterialien. Der Nachlass umfasst 4.674 Einzelnegative (Kleinbild und Mittelformate) und ist in weiten Teilen unsortiert. Fast alle Negative sind mit Original-Nummern versehen, die aufgrund der Uneinheitlichkeit eine Rekonstruktion der ursprünglichen Ordnung des Fotografen nur ansatzweise ermöglichen.
Bis 2022 wurden sukzessive ca. 650 Negative digitalisiert und größtenteils online gestellt. Zusätzlich wurden ca. 400 Datensätze angelegt, die entsprechenden Negative jedoch nicht digitalisiert. Sowohl die online gestellten als auch die vorbereiteten Datensätze wiesen, in Ermangelung von Angaben des Fotografen, zum Teil erhebliche redaktionelle Defizite auf. Die über die Jahre wechselnden Bearbeiter sind offenbar davon ausgegangen, dass es sich, wie vom Sohn des Fotografen mitgeteilt, im Wesentlichen um unveröffentlichte Fotos handeln würde. Viele Fotos wurden bildimmanent beschrieben bzw. vage räumlich und zeitlich eingeordnet. Dabei wurden diverse Vorkriegsaufnahmen irrtümlich in die Zeit der deutschen Besetzung Polens (1939-1945) versetzt oder Fotos, die auf Reisen des Fotografen z.B. in Oberschlesien entstanden sind, im Raum Łódź verortet. Aufnahmeorte, Gebäude, Personen, geschichtliche Zusammenhänge und Ereignisse wurden nur in eingeschränktem Umfang erkannt.
Unter Heranziehung verschiedener Quellen konnte nun ein deutlich verbesserter redaktioneller Stand erreicht werden. Z.B. wurden externe Sammlungen von Original-Abzügen in der Wojewódzka Biblioteka Publiczna in Łódź sowie im Bundesarchiv (in den Beständen „R 49 Bild Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums“ und „Bild 137 Deutsches Ausland-Institut“) ausgewertet. Ferner konnten zahlreiche Veröffentlichungen in der „Freien Presse“ (1940-45: „Litzmannstädter Zeitung“) und anderen zeitgenössischen Publikationen nachgewiesen werden. Diese inhaltliche Erschließung ermöglichte auch eine weitere Erfassung und Digitalisierung, so dass jetzt 1.476 Fotos von Alfred Kiss unter www.bpk-bildagentur.de hochauflösend zur Verfügung stehen.
Alfred Kiss war in der Vorkriegszeit hauptberuflich als Angestellter in der Łódźer Textilindustrie tätig und seit ca. 1934 als Fotograf aktiv. Frühe Aufnahmen dokumentieren z.B. die Beisetzungsfeierlichkeiten für den Industriellen Karl Wilhelm von Scheibler III in Łódź, 19./20. September 1934, und Kiss‘ Teilnahme an der Ostlandtagung des „Volksbundes für das Deutschtum im Ausland“ (VDA) in Königsberg mit abschließender Großkundgebung am Tannenberg-Denkmal in Hohenstein, Pfingsten 1935.
In den folgenden Jahren engagierte sich Kiss (s. Foto 70693424, 2.v.l.) in seiner Freizeit in einem vor Mai 1936 gegründeten Fotokreis des „Deutschen Vereins zur Förderung von Schulbildung und allgemeiner Bildung in Lodz“ (SBV). Dieser Fotokreis wurde von dem NS-Heimatdichter und SBV-Vorsitzenden (ab 1937) Sigismund Banek (3.v.l.) geleitet. Ziele und Aufgaben des Fotokreises formulierte Banek, der selbst nicht fotografiert hat, erstmals 1936 in der Zeitschrift „Der Deutsche Weg“, dem „Kampfblatt für volksdeutsche Arbeit“ der Łódźer Nationalsozialisten unter Ludwig Wolff.
Der Fotokreis im SBV widmete sich einer konzeptionellen, völkisch-nationalsozialistisch orientierten Heimat- bzw. Deutschtumsfotografie, die den Betrachter durch entsprechende Motivauswahl und Gestaltung „zum Volksgenossen führen“ sollte und eine vermeintlich überlegene kulturbildende Kraft der deutschen Minderheit in Polen inszenierte. Die beiden einzigen aktiven Fotografen des Fotokreises, Kiss und sein Freund und späterer Geschäftspartner Waldemar Rode (4.v.l.), ein Angestellter in einem Łódźer Fotogeschäft, unternahmen diverse Fotofahrten, die sich bis nach Wolhynien und Galizien erstreckten.
Auf diesen Fahrten porträtierten sie deutschstämmige Bauern und Werktätige als „stammesgeschichtliche“ Typen zur „Erfassung der rassischen Grundlagen unserer Volksgruppe“ (schwäbische Bäuerin, niederdeutscher Fährmann etc.) oder bei der Arbeit in ihrem „Lebenskreis“ (Bauer am Pflug, Weber am Webstuhl etc.). Daneben fotografierten sie Gehöfte, Schulen, Kirchen usw. in den von der deutschen Minderheit bewohnten Orten und Landschaften als „Zeugen des ungebrochenen Kulturwillens“. Besondere Aufmerksamkeit widmete Kiss deutschen Soldatenfriedhöfen des Ersten Weltkriegs in der Region Łódź und prangerte in einem namentlich gekennzeichneten Zeitungsartikel (der zu den wenigen hier bekannten schriftlichen Zeugnissen des Fotografen zählt) eine Vernachlässigung durch die polnischen Behörden an.
Kiss und seine Mitstreiter standen politisch dem „Deutschen Volksverband in Polen“ (DVV) nah, dessen Vorsitz 1938 Ludwig Wolff übernahm, der bereits erwähnte Anführer der im DVV organisierten Łódźer Nationalsozialisten und spätere (1940-42) NSDAP-Kreisleiter für den Stadtkreis Litzmannstadt. Diverse DVV-Veranstaltungen hat Kiss fotografisch festgehalten und seine Fotos für Ausstellungen und Publikationen des Verbands zur Verfügung gestellt.
Aufnahmen von Kiss wurden auch über Łódź hinaus in der Presse, heimatkundlichen Publikationen, Bildbänden usw. genutzt, z.B. zur Bebilderung von mit Zitaten von NS-Politikern und -Identifikationsfiguren versehenen Kalenderblättern im „Deutschen Heimatboten in Polen“, der in Poznań (Posen) von dem Volkskundler und späteren SS-Obersturmbannführer Kurt Lück herausgegeben wurde.
Anfang 1939 hat Kiss Łódź zeitweilig verlassen und ist nach Chemnitz gezogen. Es gibt Hinweise, dass er zuvor aus politischen Gründen seinen Arbeitsplatz verloren hatte. Nach dem deutschen Überfall auf Polen kehrte er in seine Heimatstadt zurück und war im Frühjahr 1940 kurzzeitig als Fotograf für die dortige Zweigstelle der von Lück geleiteten „Gräberzentrale“ in Posen tätig, in deren Auftrag er Exhumierungen von in den ersten Kriegstagen getöteten „Volksdeutschen“ zu Propagandazwecken dokumentierte.
Wie sich Rodes in Privatbesitz befindlicher und bislang unveröffentlichter Autobiographie entnehmen ließ, wurde Kiss unter Kreisleiter Wolff zum Leiter der NSDAP-Bildstelle für den Stadtkreis ernannt. Dies erklärt seine Anwesenheit als Fotograf bei zahlreichen Aufmärschen und Kundgebungen in der Stadt und der näheren Umgebung. Seinen Beruf als Spinnmeister, der noch im Chemnitzer Adressbuch genannt wird, gab er endgültig auf.
Kiss dokumentierte z.B. die Besuche des Gauleiters und Reichsstatthalters Arthur Greiser in Lodz, 7.-11. November 1939, des Reichsjugendführers Baldur von Schirach in Lodz, 13. Dezember 1939, des SA-Stabschefs Viktor Lutze in Litzmannstadt, 23. Oktober 1940, und des NSDAP-Reichsleiters und Leiters der DAF Robert Ley in Litzmannstadt, 24. März 1943. Diese und zahlreiche weitere Fotos konnten anhand von Presseveröffentlichungen zeitgeschichtlich eingeordnet werden.
Ein wichtiges Thema in Kiss‘ Tätigkeit als politischer Bildberichterstatter stellt die NS-Volkstumspolitik dar, insbesondere die Ansiedlung „volksdeutscher Umsiedler“ im sogenannten Reichsgau Wartheland („Warthegau“), der von der deutschen Besatzungsmacht völkerrechtswidrig annektiert wurde. Kiss dokumentierte auch das NS-Alltagsleben, fotografierte Straßen, Plätze und Gebäude, und nicht zuletzt die Zwangsumsiedlung der jüdischen Bevölkerung in das Getto sowie die Zerstörung Łódźer Synagogen.
Mit Rode gründete Kiss Anfang 1940 eine fotografische Werkstatt nebst Fotoagentur, die zunächst unter dem Namen „Rode-Kiss“ und dann unter „Ostlandbild“ firmierte. Das Kerngeschäft bestand im Verkauf gerahmter Fotografien. Schaufenster der „Ostlandbild“ in der Adolf-Hitler-Straße (Ulica Piotrkowska / Petrikauer Straße) fanden sich auf mehreren Aufnahmen im Nachlass.
Rode „übernahm“ dann von der Treuhandstelle das Fotogeschäft eines Polen, der zuvor in das Generalgouvernement abgeschoben worden war. Kiss konzentrierte sich weiter auf den Verkauf gerahmter Fotografien und das „Ostlandbild“-Archiv. Eine Annonce aus dem Jahr 1942 belegt, dass er zeitweilig auch mit Gemälden gehandelt hat. 1943 wurde er zum Militärdienst eingezogen.
Vermutlich wurde Kiss bei Kämpfen im Raum Hela Anfang 1945 verwundet und auf dem Seeweg nach Dänemark transportiert. Verstorben ist er laut Sterbeurkunde am 29. März 1945 in einem Kopenhagener Feldlazarett. Seine Grabstelle befindet sich, den Angaben des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge zufolge, auf dem dortigen Vestre Kirkegård.
Im Nachlass befinden sich auch diverse Gemäldefotografien, die sich, zunächst anhand einer seit dem Zweiten Weltkrieg vermissten Madonna mit Kind und Lilien aus dem 15. Jh., als Bestand des Kunstmuseums in Łódź (Muzeum Sztuki) identifizieren ließen. Diese Fotos gehörten zu einem Konvolut, das der Sohn des Fotografen zunächst als qualitativ geringwertig bzw. motivisch uninteressant aussortieren wollte. Der Fund ist in Łódź auf Interesse gestoßen, da sich eine Webseite zu den Kriegsverlusten des Museums in Planung befindet.
Im Zuge der Arbeiten hat sich ein freundlicher Informationsaustausch mit der Martin-Opitz-Bibliothek in Herne ergeben, die den fotografischen Nachlass von Kiss‘ Geschäftspartner Rode verwahrt. Dort laufen momentan ebenfalls Erschließungs- und Digitalisierungsarbeiten.
Ein polnischer Forscher hat insbesondere bei der Identifizierung von Aufnahmeorten in Łódź und Umgebung wertvolle Unterstützung geleistet.
Für eine Beschäftigung z.B. mit der Łódźer Stadtgeschichte, der deutschen Minderheit in Mittelpolen in der Zwischenkriegszeit und Themen der NS-Politik im sogenannten Reichsgau Wartheland stellt der fotografische Nachlass von Alfred Kiss eine interessante Quelle dar, die aufgrund der Überlieferungslage bislang wenig beachtet wurde.